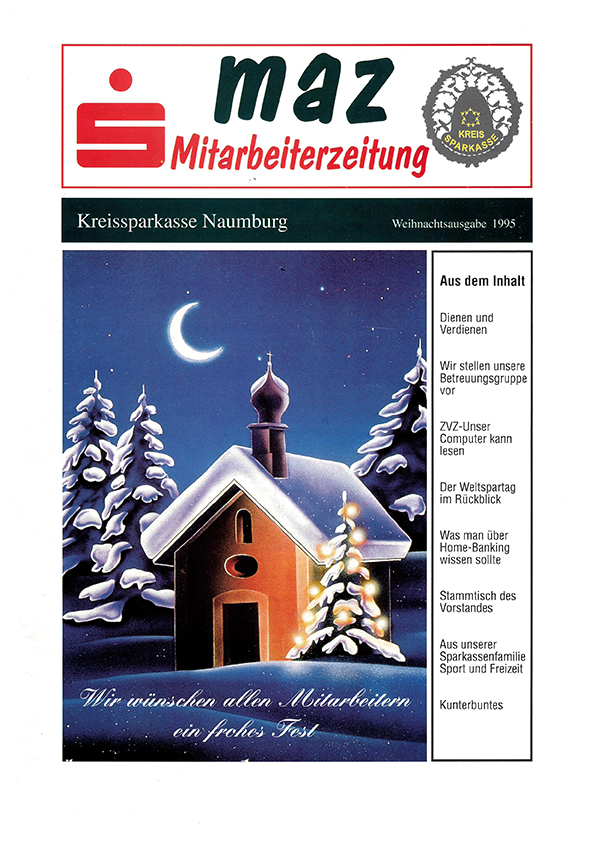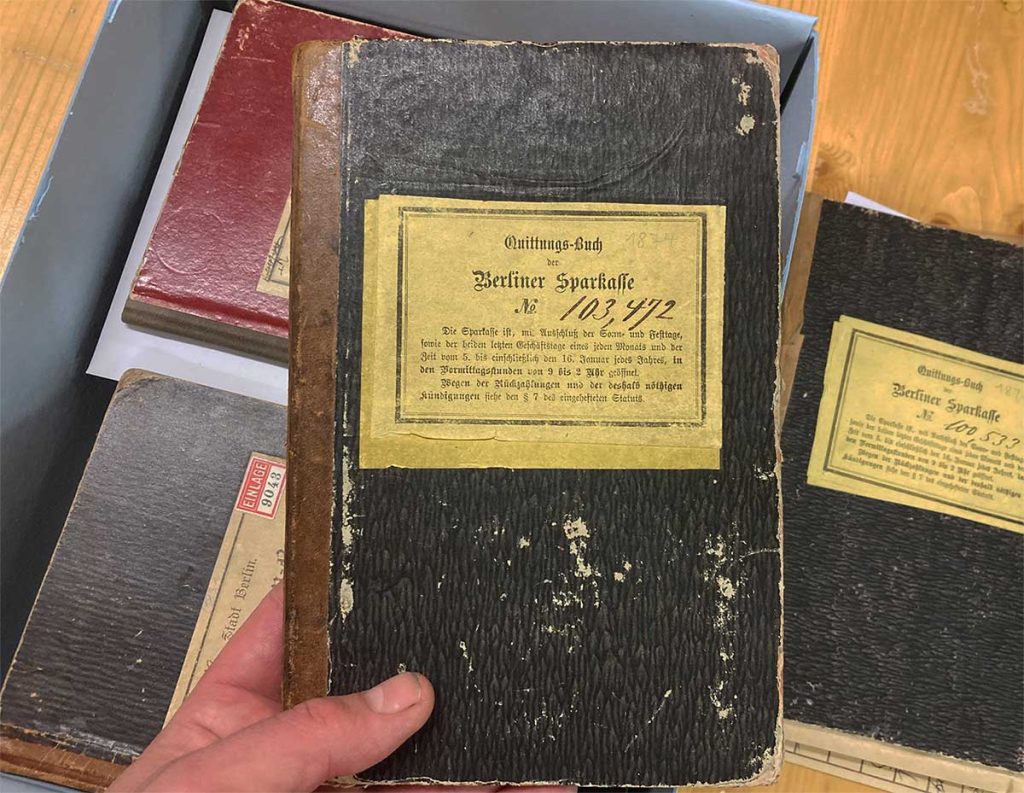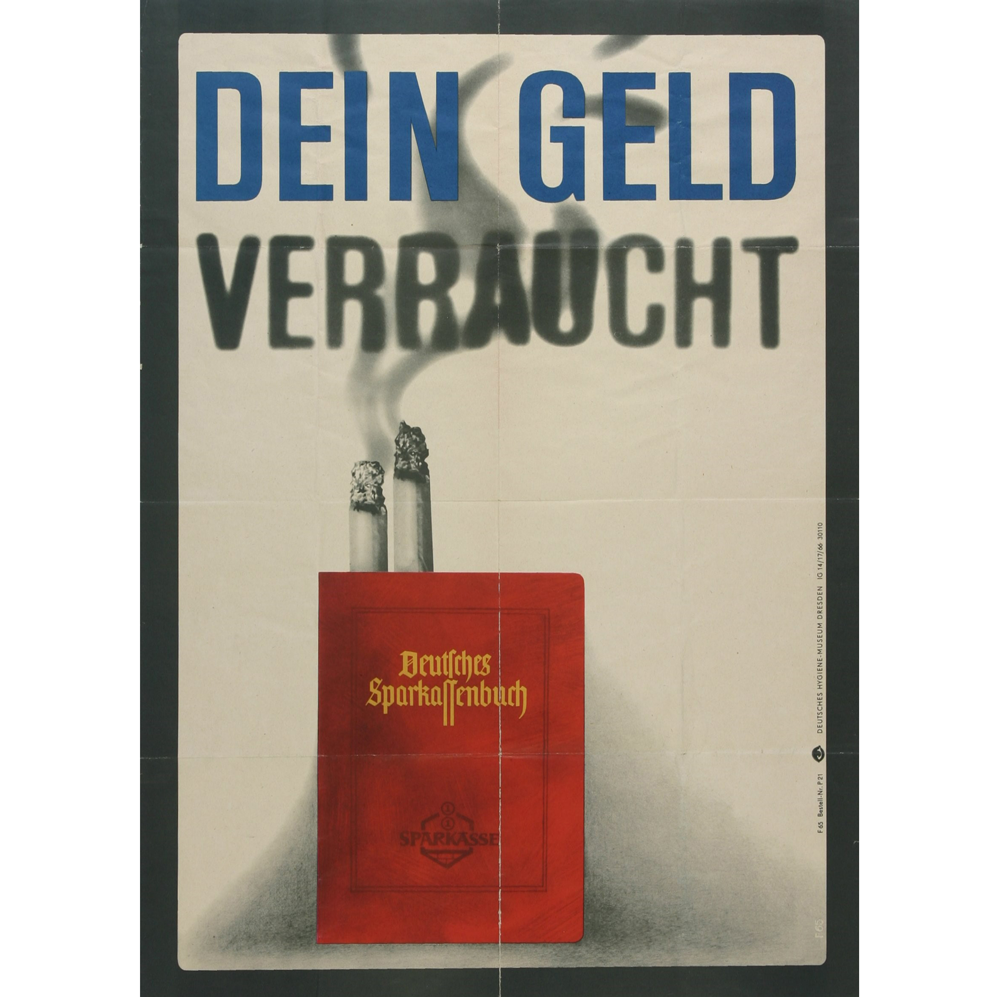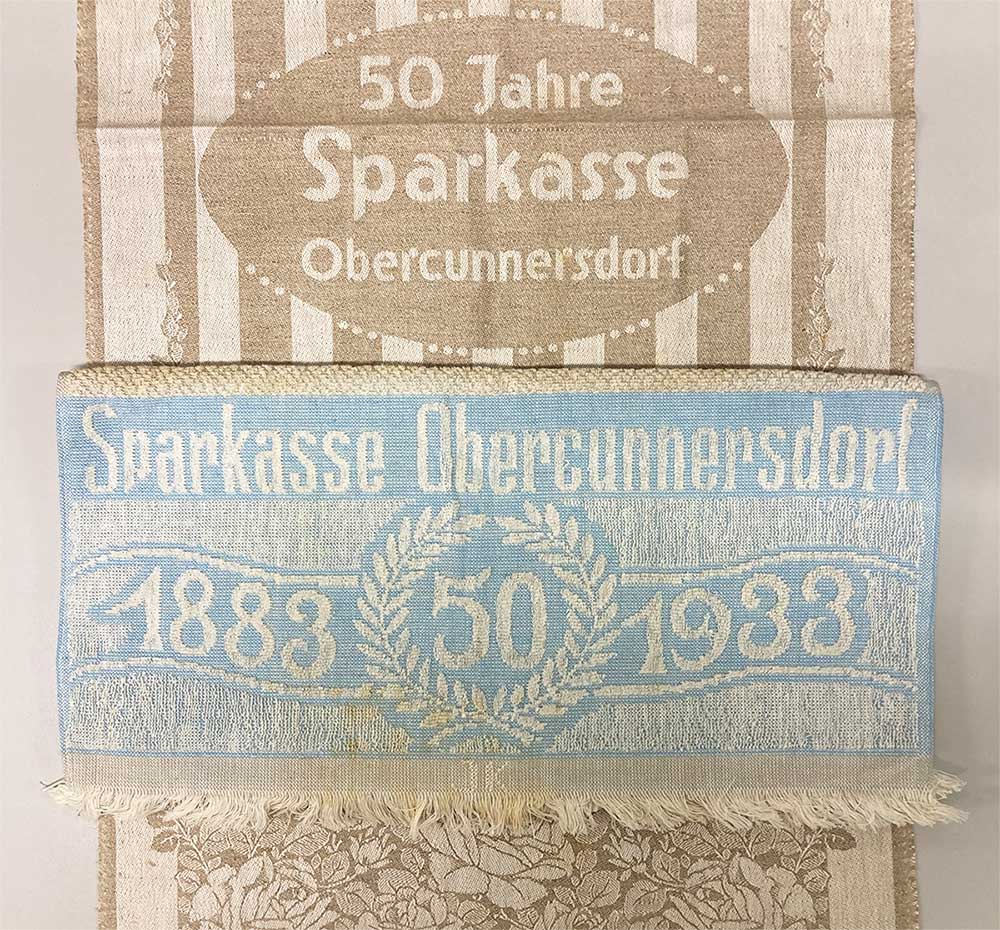Wenn wir heute an Geld denken, kommen uns vor allem Euromünzen und -geldscheine in den Sinn. Doch gab es Zeiten, in denen man an Stäbe, Kreuze, Ketten, Pfeile oder auch Delfine dachte. Denn es sind im Laufe der Geschichte unterschiedlichste Ideen entstanden, was als Zahlungsmittel im Warentausch dienen konnte.
Das Historische Archiv des OSV verfügt bereits über eine große Sammlung an Naturalgeld und anderen Zahlungsmitteln, die regelmäßig in den Wanderausstellungen bestaunt werden kann. Nun ist der Bestand in diesem Jahr um neue Schätze angewachsen. Auf einer Vertriebsveranstaltung für Sparkassen im November in Potsdam konnten Besucher die Neuzugänge zum ersten Mal bewundern.
In Rahmen meines Archivstudiums absolviere ich zurzeit ein Praktikum im Historischen Archiv. Dabei gehört es auch zu meinen Aufgaben, die neuen Zahlungsmittel zu verzeichnen, archivgerecht zu verpacken, Hintergrundinformationen zu recherchieren und Fotos zu machen. In diesem Beitrag möchte ich die neuen Objekte nun vorstellen.
Kissi-Penny
Das erste Objekt zog auf der Vertriebsveranstaltung die größte Aufmerksamkeit auf sich, nicht zuletzt wegen der ungewöhnlichen Form. Die Kissi-Penny (auch Kilindi) bestehen aus dünnen, gedrehten Eisenstäben, die an einem Ende platt gedrückt und am anderen t-förmig sind. Die Stäbe wurden im eisenreichen Westafrika (heute Guinea, Sierra Leone und Liberia) bis ins 20. Jahrhundert als Zahlungsmittel verwendet. Ihre Ursprünge reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Das Wort Kissi leitet sich von dem gleichnamigen Volk ab, dass in dieser Region noch heute lebt.
Einzelne Kissi-Penny benutzte man wie Kleingeld. Für größere Beträge wurden Bündel mit bis zu 20 Stäben verwendet. 1920 bnötigte man für den Kauf einer Kuh 30 bis 40 Bündel [1]. Bei einer Hochzeit mussten etwa 240 Bündel als Brautpreis bezahlt werden. Auch konnten die Stäbe als Rohstoff genutzt werden, da sie bei Bedarf eingeschmolzen und weiterverarbeitet werden konnten.
Delfingeld aus Olbia
Die nächste Neuanschaffung ist, mit einer Größe von 2 cm, auf dem ersten Blick wohl die unauffälligste, aber deswegen nicht weniger spannend.
Der kleine Bronzedelfin stammt aus der damals griechischen Schwarzmeerstadt Olbia (heutige Ukraine), wo er in der Antike als Zahlungsmittel verwendet wurde. Die Stadt hatte ihre Blütezeit zwischen ca. 425 und 350 v. Chr. und aus dieser Zeit kommt auch die Delfinmünze. Durch ihre Küstenlage war die Seefahrt in Olbia von zentraler Bedeutung. Auf ihren Schiffsreisen wurden die Seefahrer oft von Delfinen begleitet. So entwickelten sich diese zu positiven Symbolen, die schließlich auch für die Form von Münzen verwendet wurden [2].
Katanga-Kreuz
Das rot-lackierte Katanga-Kreuz (auch Handa oder Aspa genannt) war als Zahlungsmittel im Kongobecken gebräuchlich. Dieser x-förmige Kupferbarren hat einen Durchmesser von ca. 10 cm und wiegt etwa 200 g. Verwendet wurden die Kreuze hauptsächlich ab dem 15. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Name leitet sich von der Katanga-Region im Kongo ab, welche reich an Kupfer ist.
Hergestellt wurden die Kreuze in Tonformen, die nach dem Brennen zerstört wurden, um den Barren zu entfernen. Dies führte zu verschieden Gewichten und Größen. Für den Handel wurden auch in Europa Barren produziert, beispielsweise in Birmingham [3]. Das am häufigsten verwendete Kreuz hatte einen Durchmesser von etwa 20 cm und wog ca. 1 kg. Mit diesem konnte man 10 kg Mehl oder 5 Stück Geflügel kaufen. Es gab auch übergroße Kupferkreuze, die vermutlich mehr als Statusobjekt dienten und weniger als tatsächliches Zahlungsmittel.
Pulverglasperlenkette
Das nächste Zahlungsmittel kommt aus Afrika und besteht aus einer Kette mit 49 Perlen (auch als „Trade Beads“ bezeichnet) aus Pulverglas. Diese stammen aus Ghana von dem Volk der Krobo. Die Verwendung der Ketten lässt sich bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen. Ab dem 16. Jahrhundert waren die Glasperlen auch im Handel mit den Europäern gebräuchlich.
Die Perlen werden noch heute bei den Krobo hergestellt und als Schmuck verwendet [4]. Für das Pulverglas wird Glas gemahlen und in Tonformen langsam gebacken. Anschließend werden die Perlen bemalt und nochmal bei hohen Temperaturen kurz gebrannt.
Pfeilspitze
Pfeilspitzen waren in der Antike ein beliebtes Zahlungsmittel. Dabei waren diese meist stumpf und nicht für die Jagd oder den Kampf zu gebrauchen. Pfeilspitzen waren weit verbreitet, dadurch lässt sich der Entstehungszeitraum schwer ermitteln. Vermutlich stammt unsere aus der Bronzezeit (2200 – 800 v. Chr.).
Lukas Kirmse, Praktikant Historisches Archiv des OSV
Quellen:
[1] Money Museum: Liberia/Sierra Leone/Guinea, Volk der Kissi, 20 Kilindi, Online im Internet: URL: https://www.moneymuseum.com/de/muenzen?&id=2304 [letzter Zugriff am 06.12.2022].
[2] Money Museum: Sarmatien, Olbia, Delfinmünze, Online im Internet: URL: https://www.moneymuseum.com/de/muenzen?&id=191 [letzter Zugriff am 06.12.2022].
[3] MGM Münzlexikon: Katanga-Kreuz, Online im Internet: URL: https://www.mgmindex.de/index.php?title=Katanga-Kreuz [letzter Zugriff am 06.12.2022].
[4] YaleNews: Beads show European trade in African interior used Indigenous routes, Online im Internet: URL: https://news.yale.edu/2022/09/15/beads-show-european-trade-african-interior-used-indigenous-routes [letzter Zugriff am 08.12.2022].