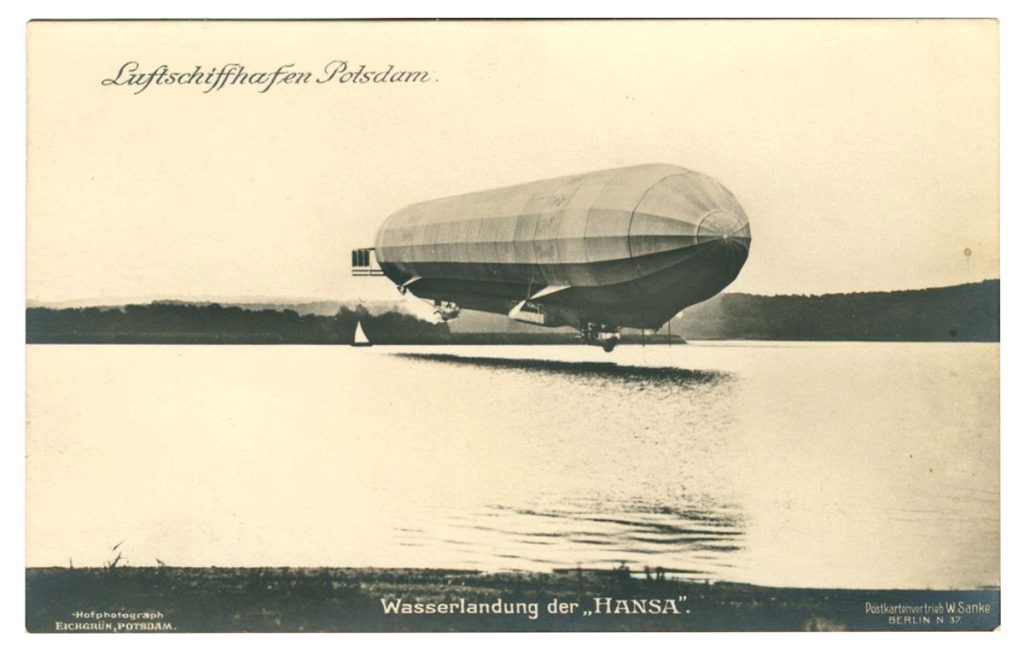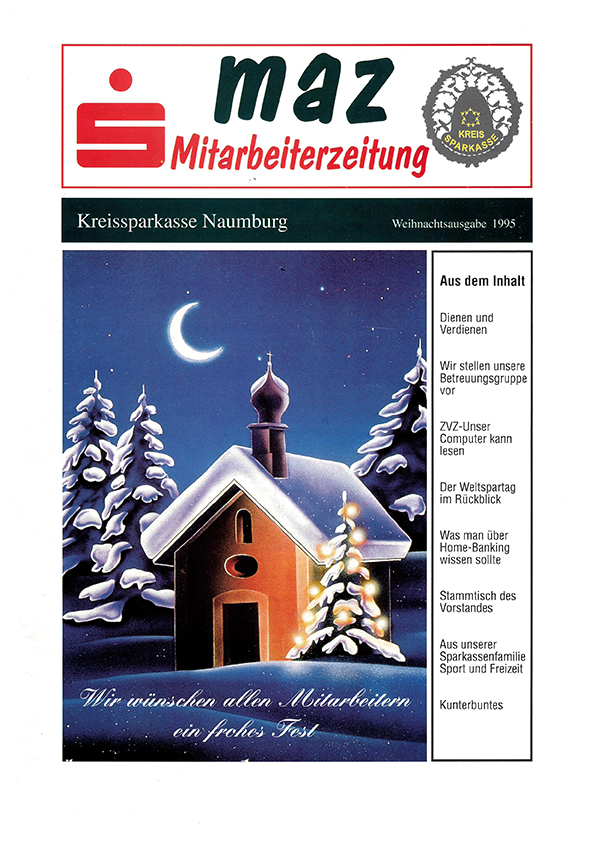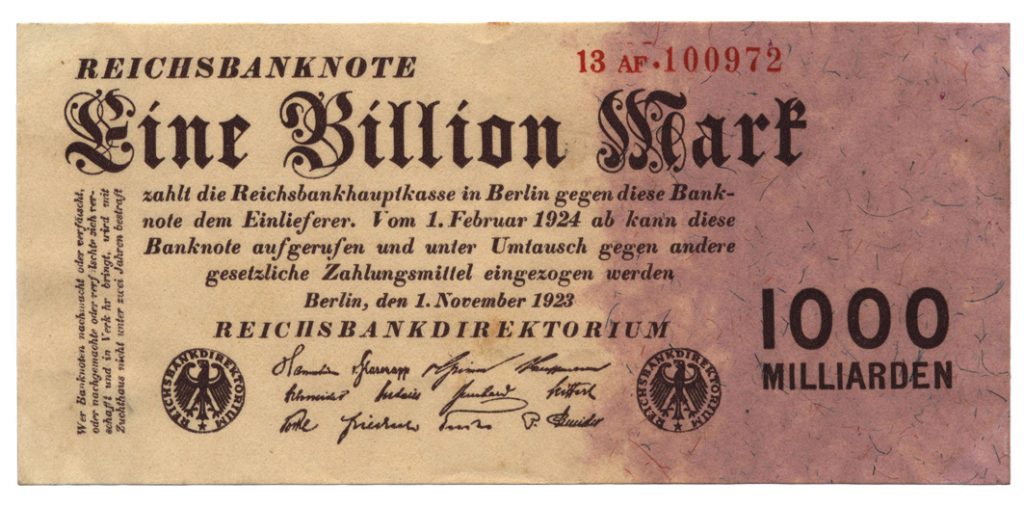Das Historische Archiv im Jahresbericht
Vor kurzer Zeit hat der Ostdeutsche Sparkassenverband seinen Jahresbericht für 2023 online veröffentlicht. Auch das Historische Archiv wurde bedacht und taucht hier mit drei Projekten des vergangenen Jahres auf. Als großes Titelbild begegnet uns der historische Sitz der Sparkasse Elbe-Elster in Finsterwalde. Diese Postkarte wurde 1929 versendet. Da war das Gebäude links ganz neu. Am 18. Juni 1928 konnte die Stadtspar- und Girokasse Finsterwalde dort einziehen.
Vom Architekten und Regierungsbaumeister a.D. Kurt Vogeler stammt der Entwurf für das Haus. Der Bildhauer Walter Lemcke gestaltete unter anderem die interessanten Sandsteinfiguren an der Fassade. Sie nehmen Bezug auf örtliche Wirtschaftszweige, mit denen das Geldinstitut Geschäftsbeziehungen pflegte. Schauen Sie sich gern das zweite Bild des Blogs an. Über dem Eingangsportal sehen Sie links Merkur, den antiken Gott/ Schutzpatron der Reisenden, des Handels und der Wissenschaften. Rechts symbolisiert eine Frau die Güterzeugung, die Industrie.
Das ehemalige Postamt ist seit Anfang 2002 Teil der neugestalteten Hauptstelle der Sparkasse Elbe-Elster. Ein Um- und Erweiterungsbau erfolgte, der wertvolle alte Bausubstanz erhielt und historische mit moderner Architektur verband. Auch das Sparkassengebäude von 1928 wurde damals umgebaut. Die Fassade blieb dabei erhielten, wie schon bei einer weitreichenden Umgestaltung in den Jahren 1991/1992.