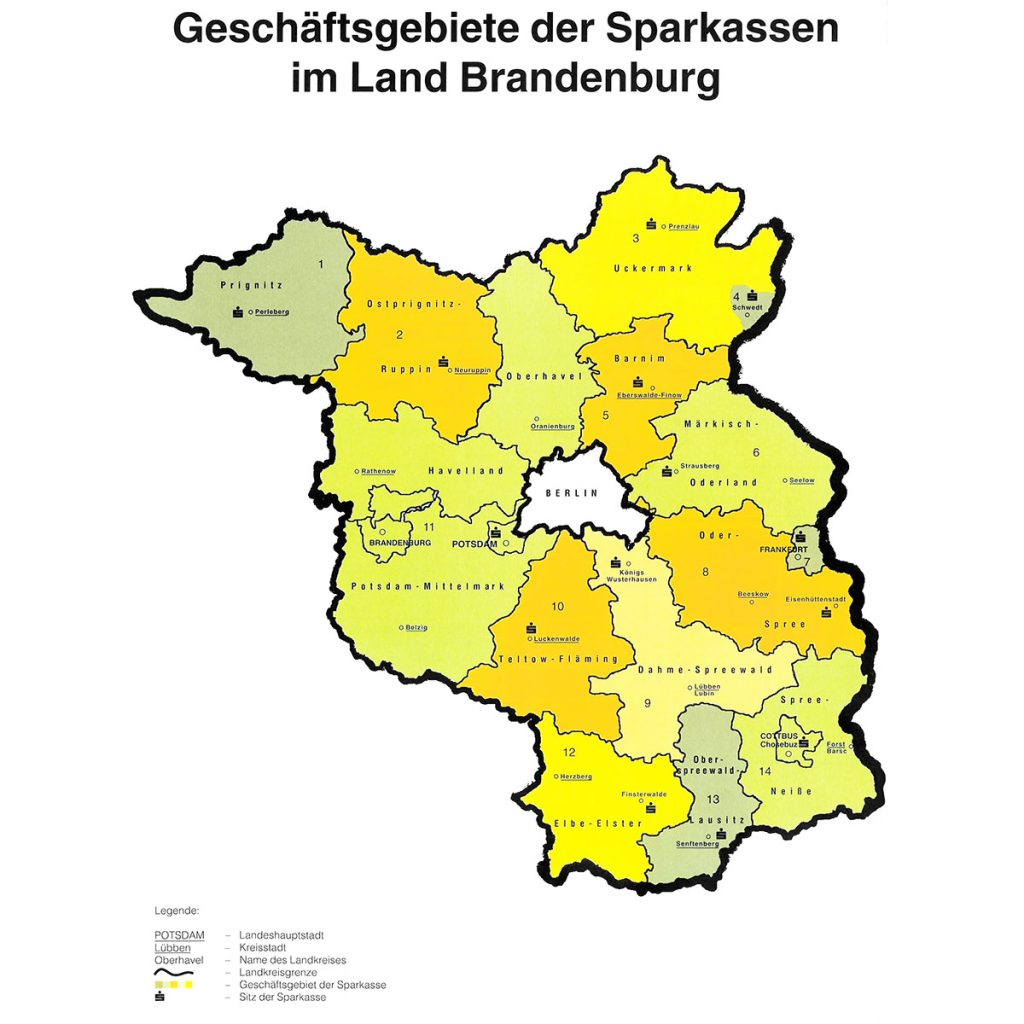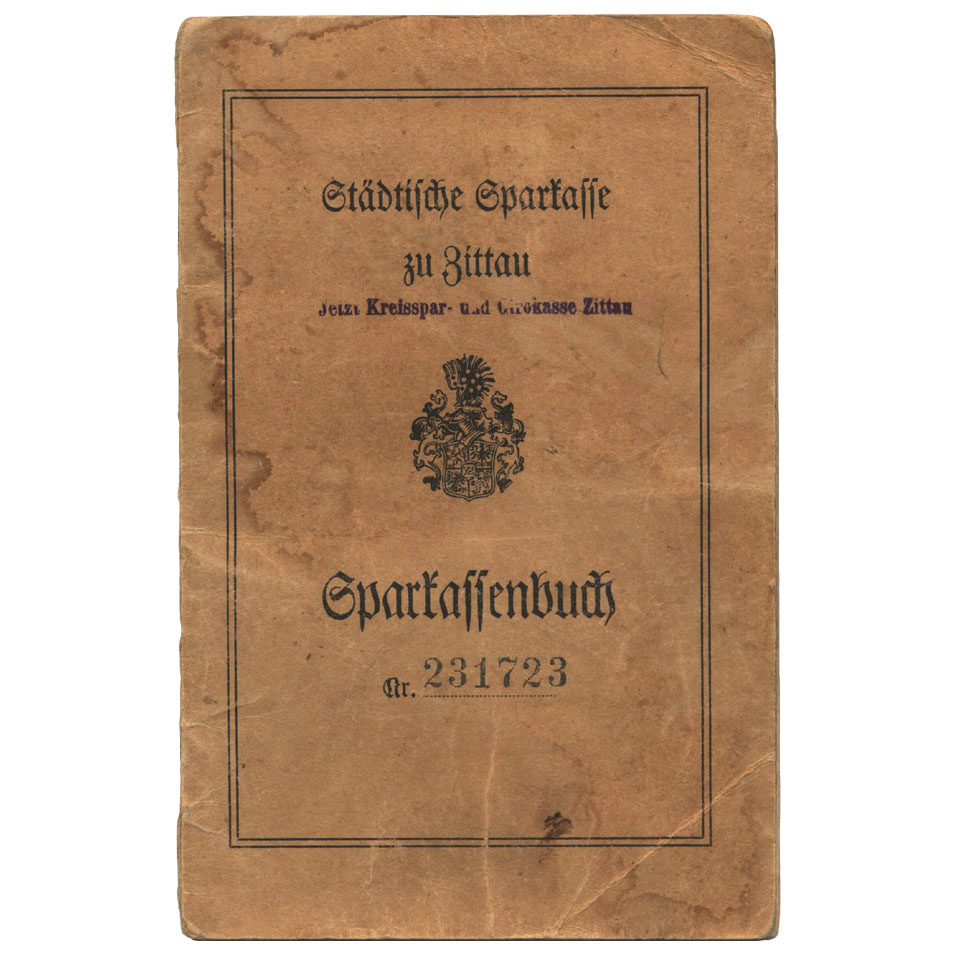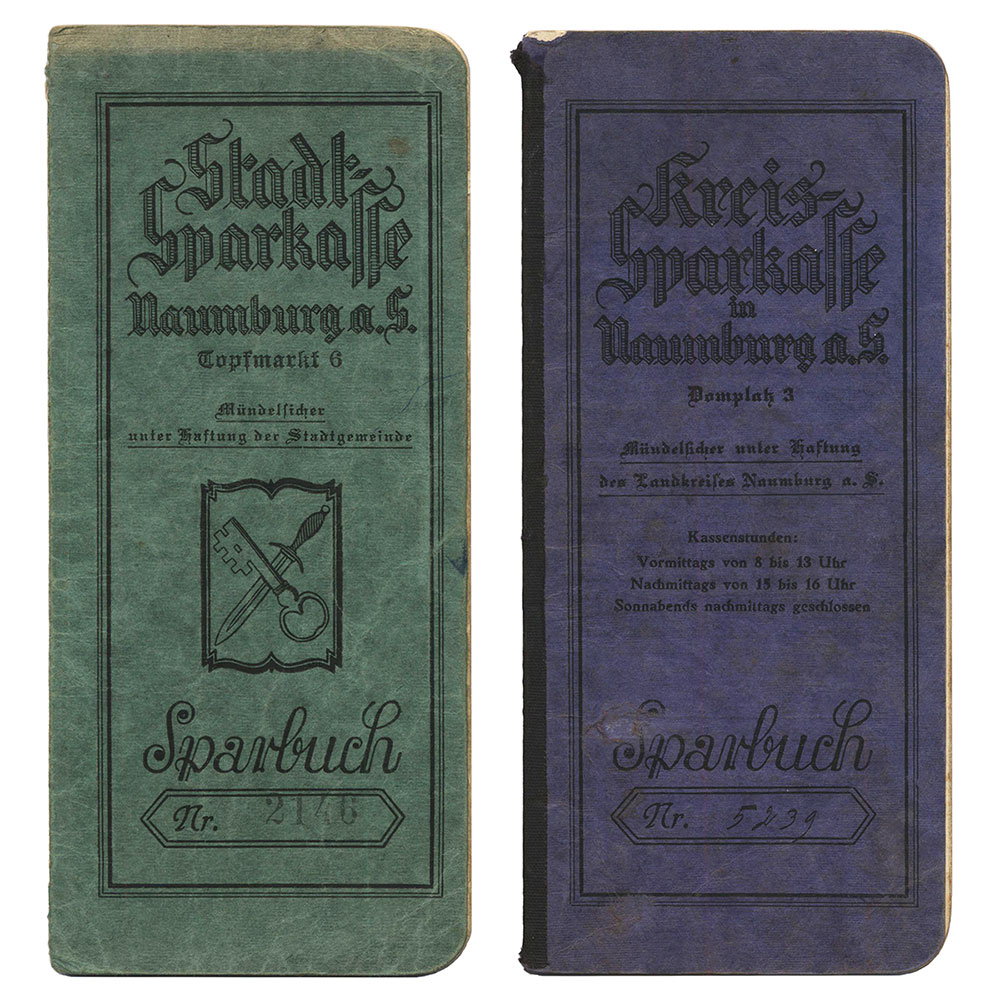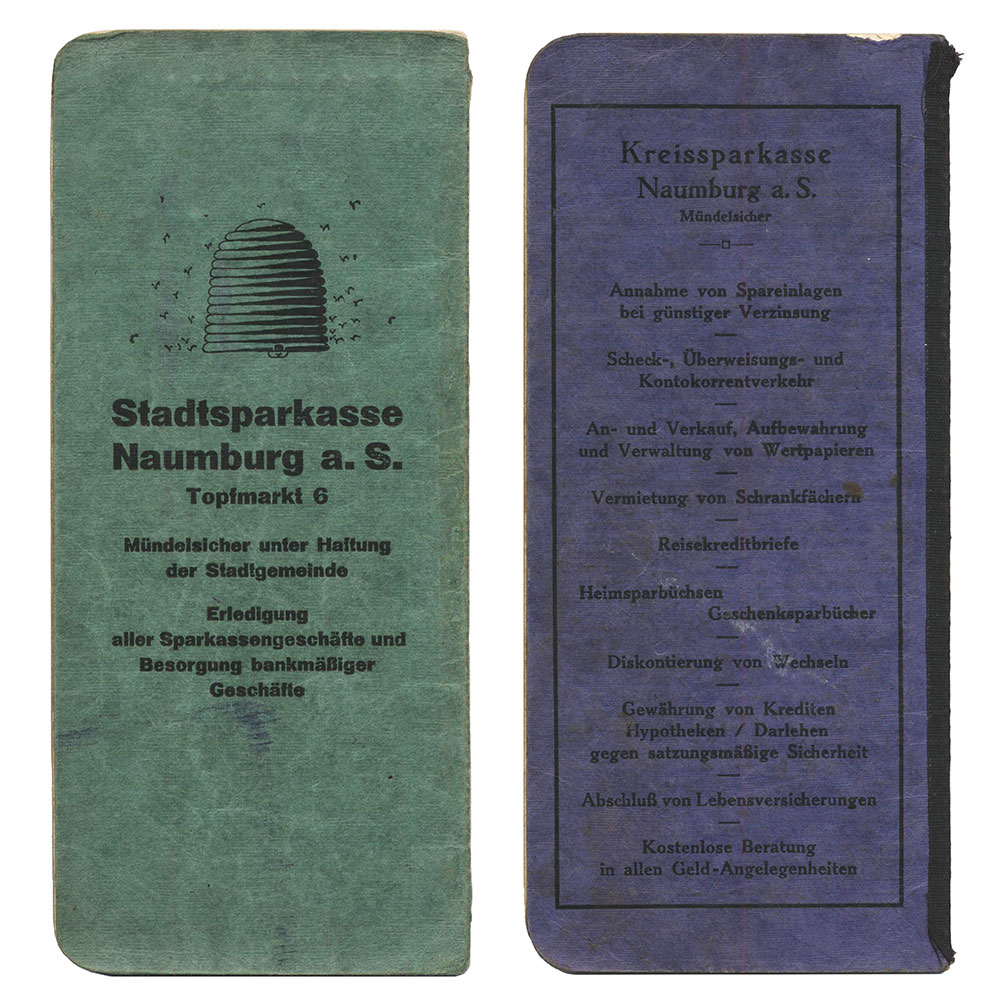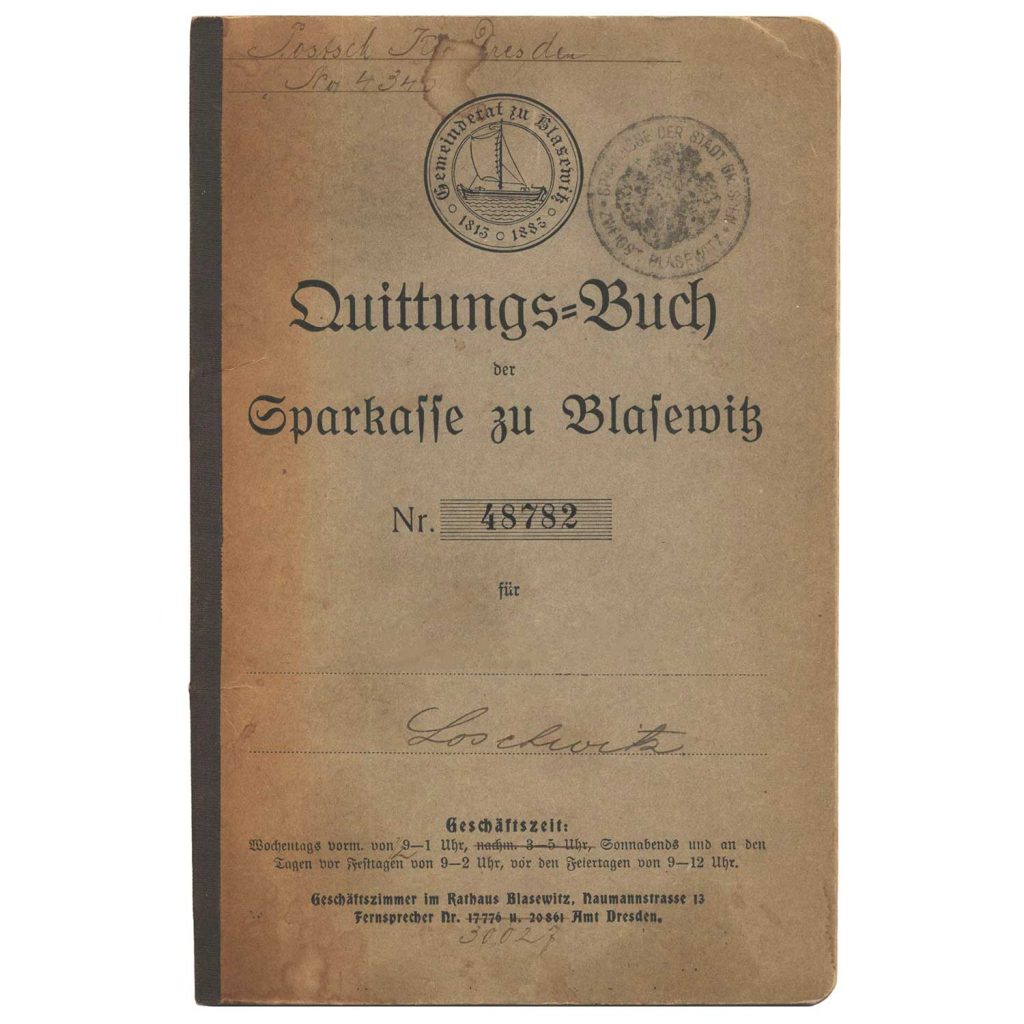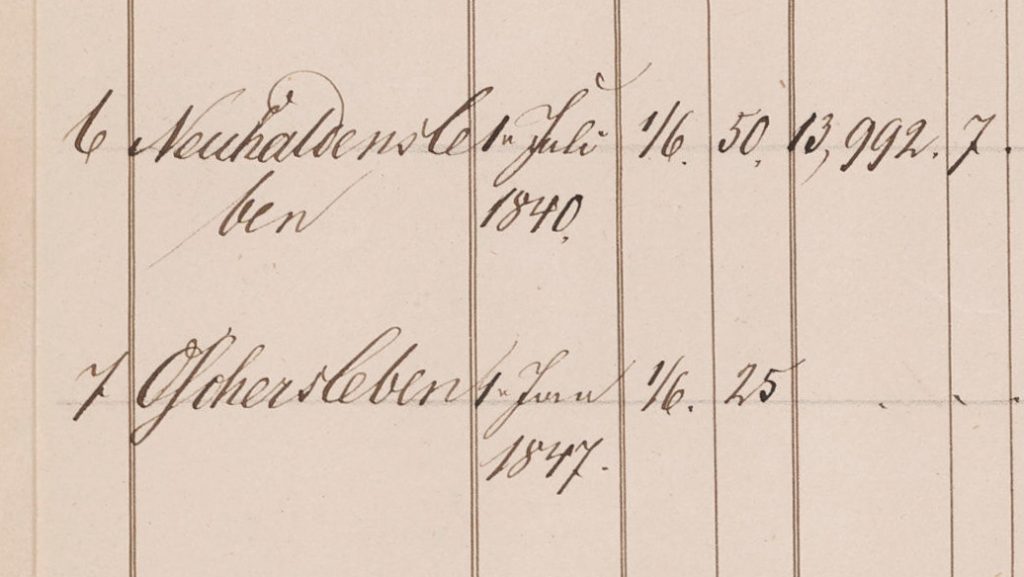Zwei Doppeljubiläen
Nun ist das neue Jahr bereits einige Tage alt und die Sparkasse Wittenberg mittlerweile 30 Jahre jung. Sie entstand am 1. Januar 1994 aus den Kreissparkassen Jessen und Wittenberg. Einen gewichtigeren Anlass für ein Jubiläum gibt es jedoch bald. Die Sparkasse gibt nämlich als ursprüngliches Gründungsjahr 1824 an und wird demnach bald 200. Am 10. März 1824 beschloss die Stadt Wittenberg die Gründung einer Sparkasse. Die erste Einzahlung fand nach der Eröffnung am 5. Januar 1825 im Rathaus statt.
Auch die Sparkasse der Stadt Wismar nahm den Geschäftsbetrieb im Rathaus auf, am 2. Januar 1825. Der Beschluss des Stadtrates zur Einrichtung dieses Geldinstitutes war am 23. Juni 1824 erfolgt. Ebenfalls im Juni, und zwar am 1. im Jahr 1994, verschmolzen die Kreissparkassen Gadebusch und Grevesmühlen sowie die Sparkasse Wismar zur heutigen Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Sie beruft sich ebenfalls auf die kommunale Entscheidung im Jahr 1824, wenn es um das Datum ihrer historischen Gründung geht.